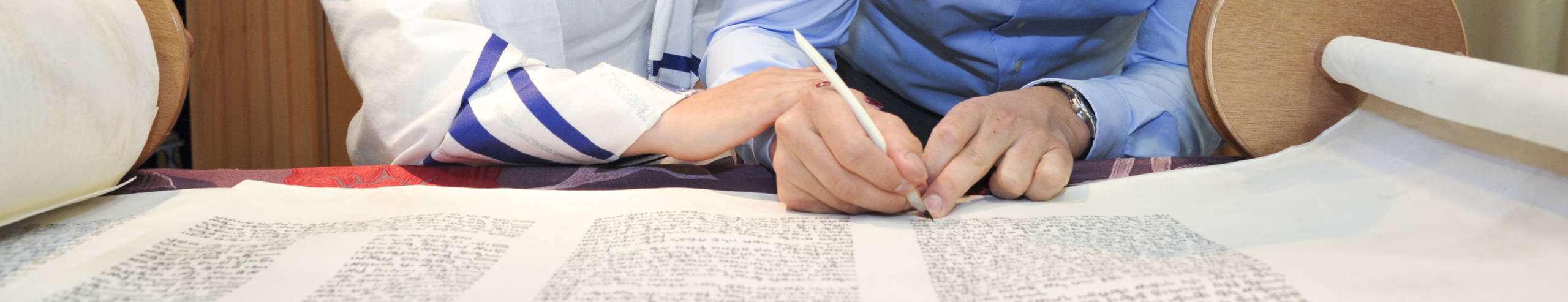Likrat Schabbat
Likrat Schabbat, mit dem ich Sie erreichen möchte, bedeutet «auf zu Schabbat» und bezieht sich auf ein Zitat von Rabbi Chanina, aufgezeichnet im Talmud Bawli (Schabbat 119a) und aufgenommen in unserem Siddur (S. 67):
באו ונצא לקראת שבתה מלכה – «Kommt lasst uns die Königin Schabbat willkommen heissen.» Ich hoffe aus ganzem Herzen, dass Likrat Schabbat Ihnen hilft, sich auf die wöchentliche Begegnung mit Schabbat zu freuen und Schabbat zu einer speziellen, beruhigenden und vielleicht sogar nährenden Zeit zu gestalten.
Rabbiner Ruven Bar Ephraim
Seit Mitte November 2025 hat Eli Carvajal das Schreiben von Likrat Schabbat übernommen.
Gerne senden wir Ihnen Likrat Schabbat auch per E-Mail zu. Senden Sie eine entsprechende Nachricht an unser Sekretariat
Sidra Bo, 06. Schewat 5786
Toralesung: Schemot (2BM) 10:1 - 11:3; Haftara: Jirmija 46:13 - 28
23.01.2026 18.45 Ma’ariw leSchabbat
24.01.2026 09.30 Simcha leSchabbat
10.00 Schacharit leSchabbat
In Paraschat Bo erscheint eine der beunruhigendsten Plagen: die Finsternis. Nicht, weil sie körperlich schmerzt, sondern weil sie lähmt.
Die Tora formuliert dies sehr präzise: וְלֹא־רָאוּ אִישׁ אֶת־אָחִיו וְלֹא־קָמוּ אִישׁ מִתַּחְתָּיו שְׁלֹשֶׁת יָמִים
«Niemand konnte seinen Bruder (den anderen) sehen, und niemand konnte sich drei Tage lang von seinem Platz bewegen.» (Schemot 10,23)
Man könnte meinen, das Problem sei einfach das Fehlen von Licht. Doch der Vers sagt nicht nur, dass man nichts sah, sondern dass man seinen Bruder nicht sah. Die Tora richtet den Blick auf die menschliche Beziehung.
Meiner Meinung nach ist diese Finsternis nicht nur physischer Natur. Es geht nicht darum, Gegenstände nicht erkennen zu können, sondern um eine Erfahrung völliger Isolation. Jeder Mensch ist in sich selbst eingeschlossen, unfähig, sich auf den anderen zuzubewegen, ja sogar unfähig, ihn als bedeutende Präsenz wahrzunehmen.
Und das ist entscheidend: Die tiefste Dunkelheit ist nicht, nichts zu sehen. Sie besteht darin, den anderen nicht zu sehen.
Ägypten hat sich im Laufe dieser Geschichte zunehmend entmenschlicht. Zuerst macht es ein ganzes Volk zu anonymer Arbeitskraft. Dann befiehlt es, neugeborene Babys zu töten. Schliesslich erreicht es einen Punkt, an dem Menschen einander nicht mehr als Brüder wahrnehmen können. Die Gesellschaft bricht von innen heraus zusammen.
Deshalb zerstört diese Plage keine Gebäude und keine Körper, sondern etwas viel Zerbrechlicheres: das soziale Gefüge. Hier zeigt sich der entscheidende Kontrast:
וּלְכָל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָיָה אוֹר בְּמוֹשְׁבֹתָם
«Aber für alle Kinder Israels war Licht in ihren Wohnstätten» (Schemot 10,23)
Das Licht Israels wird nicht als kosmisches oder spektakuläres Phänomen beschrieben, sondern als etwas, das in geteilten Räumen existiert: in den Häusern, an den Orten der Beziehung, des Wortes und der Weitergabe. Die Tora sagt damit etwas sehr Starkes: Licht ist nicht nur eine äussere Bedingung; es ist eine Art, mit anderen zu sein.
Das spricht direkt in unsere Gegenwart hinein. Wir können in Gesellschaften mit Elektrizität, Bildschirmen und ständiger Information leben und dennoch tief in der Dunkelheit sein, wenn wir aufhören, den anderen als Bruder zu sehen – oder sogar einfach als einen anderen Menschen. Wenn jeder in seiner eigenen Angst, in seiner eigenen Geschichte, in seinem eigenen Rückzug erstarrt.
Paraschat Bo lehrt uns, dass Freiheit nicht erst dann beginnt, wenn der Unterdrücker fällt. Sie beginnt, wenn eine Gesellschaft wieder lernt, einander zu erkennen. Aus Ägypten auszuziehen bedeutet nicht nur, eine Grenze zu überschreiten.
Es bedeutet, wieder zu lernen, den Menschen neben sich zu sehen.
Schabbat schalom
Eli Carvajal